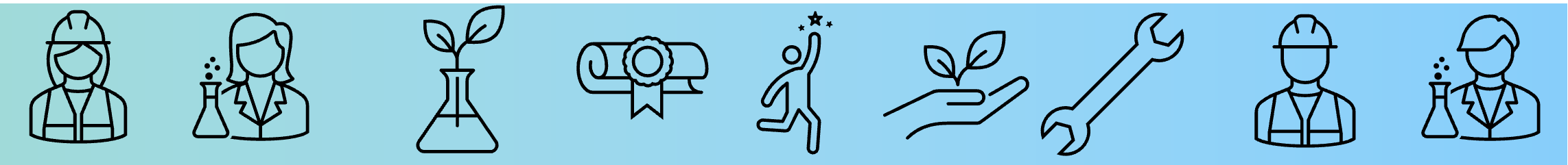 Einführung
Einführung
Der erfolgreiche Markthochlauf von Technologien rund um grünen Wasserstoff kann ohne qualifizierte Fachkräfte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nicht stabilisiert werden. Die Einführung neuer und Umstellung bisheriger Prozesse und Technologien hängen davon ab, ob sie von genügenden qualifzierten Fachkräften umgesetzt werden können. Ein eventueller Fachkräftemangel wäre insofern eine zentrale Hemmschwelle für Innovationsprozesse und den Hochlauf von Wasserstofftechnologien. Zwar lassen sich derzeit nur Prognosen geben, grundsätzlich wird jedoch davon ausgegangen, dass ein optimistisches Szenario mit einem erfolgreichen Markthochlauf zumindest beschäftigungserhaltend oder sogar beschäftigungssteigernd wirken kann. Wie viele Arbeitsplätze dabei geschaffen werden können, hängt grundsätzlich von den zugrundeliegenden Prognosemodellen ab, weshalb die Spannweite an Schätzungen noch sehr hoch ist. So schätzen Schur et al. (2023) das Beschäftigungspotenzial durch den Hochlauf von H2-Technologien zwischen 61.000 und 89.000 neuen Arbeitsplätzen bis 2045 ein.
Qualifizierung: spezifische Bedarfe vs. allgemeine H2-Fachkraft?
Über quantitative Prognosen hinaus zeichnet sich jedoch ab, dass sich viele Beschäftigte aufgrund der Querschnittsfunktion grüner Wasserstofftechnologien durch eine Reihe von Anwendungsfeldern neue Kenntnisse und Qualifikationen aneignen müssen, um die Transformation ihrer Betriebe bewältigen zu können. Andere müssen wiederum gänzlich neue Produkte herstellen oder Verfahren etablieren, die es bisher noch nicht gab. Die genauen Inhalte der Weiterqualifizierungen sind insofern von vielen Faktoren abhängig, die oftmals von Betrieb zu Betrieb variieren. Dennoch steht bisher fest, dass die Bedarfe an Weiterqualifizierung facettenreich sowie eng mit der Entwicklung des Markthochlaufs verknüpft sind und sich über ein breites Spektrum an Beschäftigungsfeldern, Berufsbezeichnungen und Qualifikationsstufen erstrecken. Insofern wird es zunächst nicht darum gehen, ein neues Berufsbild als „Wasserstofffachkraft“ als Allrounder für den Arbeitsmarkt von morgen auszubilden. Vielmehr gilt es, die heutigen Fachkräfte weiterzubilden und auf die Transformation vorzubereiten sowie bei Auszubildenden und Studierenden Wasserstoff-relevante Inhalte im Lehrplan zu platzieren. Zentral ist hierbei die passende Ermittlung von Qualifizierungsbedarfen in spezifischen betrieblichen Kontexten und ihre Übersetzung in den (Weiter-) Bildungsbereich.
Fachkräfte, die heute bereits mit Wasserstofftechnologien arbeiten, sind meist Spezialist:innen, die sich die entsprechenden Kenntnisse über einen längeren Zeitraum „on the job“ aneignen konnten. Dennoch werden viele Qualifikationen, die heute bereits bei Fachkräften vorhanden sind, für Wasserstoffanwendungen ebenfalls von großer Relevanz sein. Insbesondere im naturwissenschaftlich-technischen Bereich sind akademische und gelernte Fachkräfte mit Kenntnissen ausgestattet, die auf eine Transformation mit grünem Wasserstoff übertragbar sind, beispielsweise in der Projektierung, im Programmieren oder im Bau von Anlagen. Hier gilt es, einerseits bei Weiterbildungsangeboten auf diesen Fertigkeiten aufzubauen und andererseits sicherzustellen, dass innerhalb der Betriebe Wasserstoff-Wissen zwischen den Beschäftigten diffundieren kann, wofür vor allem eine ausgeprägte Einarbeitungskultur unabdingbar ist.
Eine Bildungsoffensive im Bereich Wasserstoff – systemisch eingebettet mit anderen Energieträgern und -technologien – birgt großes Potenzial, die Transformation zu stabilisieren, Unternehmen abzusichern, die Verhandlungsposition von Beschäftigten zu stärken und strukturschwache Regionen zu fördern. Fördernd wirken hierbei die Zusammenarbeit von Bildungsträgern mit lokalen Unternehmen und Ausbildungsbetrieben und die Einbindung von Bildungsinitiativen in offizielle Förderungsstrukturen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels können Betriebe mit guten Arbeitsbedingungen qualifizierte Fachkräfte binden: Hierzu zählen beispielsweise Tarifbindung, Bemühungen um die Work-Life-Balance und eine solidarische Unternehmenskultur, die Nachhaltigkeitsaspekte als Berufsethos integriert. Ebenso bergen die Interessenvertretungen der Beschäftigten, also Betriebsräte, Vertrauensleute und Gewerkschaften, großes Potenzial, qualifizierungsfördernde Strukturen zu etablieren. So wäre z.B. ein Wasserstoff-fokussiertes Bildungsmentor:innen-Programm zu begrüßen, durch das spezifische Bedarfe an Qualifizierungsmaßnahmen ermittelt werden und Beschäftigte sich gegenseitig durch Veränderungsprozesse begleiten können. Eine strategische Personalplanung, die Bildungsbedarfe frühzeitig erkennt und Qualifizierung ermöglicht, stellt nicht nur ein wichtiges Aufgabenfeld für Personalverantwortliche, sondern auch für Betriebsräte dar, die durch ihr Initiativrecht bei Weiterbildungen eine zentrale Rolle übernehmen und die Qualifizierung der Beschäftigten betriebsintern forcieren können.
Hürden der Qualifizierung
Die Hürden bei der Qualifizierung von Fachkräften sind vielfältig und hängen eng mit den allgemeinen Hemmnissen des Markthochlaufs zusammen. So bremsen beispielsweise bürokratische Prozesse die Geschwindigkeit der Implementierung und offiziellen Anerkennung von H2-Modulen in Ausbildung und Studium. Ebenso werden bei der Genehmigung und Verwaltungen von Verfahren, Technologien und Infrastruktur bürokratische Hürden sichtbar, die durch aufwendige Verwaltungsverfahren erzeugt werden, was aufgrund mangelnden Personals in entsprechenden Behörden weiter verstärkt wird.
Bei den Beschäftigten kann die Bereitschaft zur Weiterqualifizierung aus unterschiedlichen Gründen gering sein: Ältere Beschäftigte halten möglicherweise stärker an gewohnten und bewährten Praktiken bis zum Renteneintritt fest. Jüngere Beschäftigte sind womöglich eher von den Belastungen bestimmter Berufe (z.B. Industriemechaniker:in) und den langfristigen Perspektiven von Betrieben in der Transformation verunsichert oder grundsätzlich unschlüssig, ob sie sich in bestimmten (Thüringer) Regionen niederlassen wollen. Hinzu kommt, dass der Zugang zu Bildungsangeboten ungleich zwischen Unternehmen verteilt ist: Während sich große Unternehmen entsprechende Dienstleistungen eher leisten können, ist es für KMUs umso schwieriger, bezahlbare Bildungsangebote zu finden. Ebenso muss die Weiterqualifizierung von Fachkräften damit austariert werden, dass diese aufgrund der durch den Fachkräftemangel angespannten Personalsituation kaum für längere Zeit freigestellt werden können.
Allgemein sind Unternehmen stark vom Fachkräftemangel betroffen, der in Zeiten gewisser Unabwägbarkeiten des Markthochlaufs von grünem Wasserstoff die Suche nach qualifiziertem Personal zusätzlich erschwert und bedingt, dass viele erfahrene Beschäftigte den Betrieb verlassen werden, was dem Wissenstransfer zwischen Beschäftigten schadet. Dabei spielt auch eine Rolle, inwiefern eine Umstellung auf grünen Wasserstoff für das eigene Unternehmen ein Risiko darstellt: dies beinhaltet z.B. die Fragen, ob die zum Einsatz kommenden Technologien auf industrielle Maßstäbe skalierbar sind, welche Garantien für einen erfolgreichen Markthochlauf, der faire Wettbewerbsbedingungen erlaubt, gegeben werden können, wie der Transport des Wasserstoffs erfolgen soll und ob dieser in relevanten Mengen zu wettbewerbsfähigen Preisen geliefert werden kann. Eine grundsätzliche Voraussetzung dafür ist ein stärkerer Ausbau erneuerbarer Energien.
Ein einheitlicher Trend kann (noch) nicht ausgemacht werden, jedoch besteht derzeit die Tendenz, bei der Qualifizierung von H2-Fachkräften auf erste Weiterbildungsmaßnahmen zu setzen, die allgemeine Kenntnisse zu Wasserstoff(-technologien) vermitteln. So lassen sich die Beschäftigten sensibilisieren und mit umfänglichen Basis-Kenntnissen zu Wasserstoff ausstatten, die sie auf weitere Spezialisierungen in den für sie relevanten Arbeitskontexten und -prozessen vorbereiten. Hierzu zählen Kenntnisse zur Erzeugung, Speicherung und Transport von Wasserstoff, seiner ökologischen und ökonomischen Relevanz, zu bestimmten Endanwendungen, wie in der Brennstoffzelle, seiner chemischen Beschaffenheit sowie Weiterbildungen zu Sicherheitsaspekten, Explosionsschutz, Hochvoltschulungen, aber auch zu Vorschriften, Standards und Normen.
Weiterbildung in der H2-Well Region
In Thüringen sind besonders drei Programme zur Weiterbildung rund um Wasserstoff hervorzuheben, die als best practice Beispiele fungieren können. Auf diesen Programmen aufbauende, vertiefende Spezialisierungsmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu entwickeln, wird ein zentraler nächster Schritt in der flächendeckenden Weiterbildung von Fachkräften zu Wasserstoff sein.
Im Ausbildungsbereich tut sich die Staatlich Bildende Berufsschule Sonneberg durch ihre Kooperation mit dem HySON-Institut und der IHK Südthüringen für die Sommerakademie zu Wasserstoff hervor, durch die Auszubildende umfänglich an das Thema Wasserstoff anhand von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen herangeführt werden.
Im universitären Bereich erarbeitet die Professur für Energiesysteme an der Bauhaus-Universität Weimar Lehrkonzepte, mit denen vor allem Studierenden der Ingenieurwissenschaften ein ganzheitliches Bild zu grünem Wasserstoff vermittelt werden soll. Die Relevanz von Wasserstoff wird hier nicht nur anhand einzelner Anwendungsmöglichkeiten gelehrt, sondern systemisch eingebettet und ins Verhältnis zu anderen Energieträgern gesetzt. Ebenso werden die sozialen und ökonomischen Auswirkungen von Wasserstoffsystemen und -anwendungen mit den Studierenden untersucht.
Bei der Qualifizierung bereits in den Arbeitsmarkt integrierter Fachkräfte ist besonders der Zertifikatslehrgang Fachexperte für Wasserstoffanwendungen zu nennen, der vom HySON-Institut und der IHK Südthüringen entwickelt wurde und mittlerweile bundesweit angeboten wird. Hier wird Fachkräften aus unterschiedlichsten Bereichen grundlegendes Wissen zu grünem Wasserstoff und seinen Anwendungsmöglichkeiten vermittelt.
https://hyson.de/unternehmen/karriere/events/details/lehrgang-zum-wasser-stoff-experten-2.html
Zum Weiterlesen